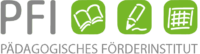2 – Die Bedeutung des Rechtschreibunterrichts
2.1 Von LRS zu funktionalem Analphabetismus
Die UNESCO deklarierte schon 1948 das Alphabetisiertsein als grundlegendes Menschenrecht. Sie sieht für die Alphabetisierungsdekade 2003-2012 eine Halbierung der Analphabetenrate weltweit vor (Lindig, 2008, 7 ff.). Der Bundesverband Alphabeti-sierung ging bisher „nur“ von 4 Mio. Erwachsenen in Deutschland aus, die Probleme beim Lesen und Schreiben hätten (Döbert & Hubertus, 2000, 8).
Jedoch sind laut Leo-Studie von 2011 mehr als 14% (ca. 7,5 Mio.) der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland funktionale AnalphabetInnen. Das bedeutet, sie können keine zusammenhängenden kürzeren Texte lesen und/oder schreiben, die über einzelne Sätze hinausgehen. Weitere 25% erreichen in der Rechtschreibung und/oder beim Lesen nicht einmal das Grundschulniveau. Sie können selbst gebräuchliche Wörter nur fehlerhaft oder langsam lesen und schreiben (Grotlüschen & Wibke, 2011, 4). Daraus folgt, nur ca. 61% der gesamten Bevölkerung in Deutschland beherrschen das Lesen und Schreiben ausreichend gut, um den Zugang zur heutigen Informations- und Kommunikationsgesellschaft selbstbestimmt und kritisch wahrnehmen zu können.
Etwa 7,5% aller SchülerInnen verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss (Klemm, 2010, 8). Die Nachqualifizierungsmaßnahmen wiederum kosteten pro Altersjahrgang 204 Millionen Euro. Deshalb schlägt KLEMM (2010, 8) vor, diese Kosten schon für die Prävention auszugeben.
Die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 geht von Leseproblemen bei einem Viertel aller 15-Jährigen aus (Stanat, u.a., 2002, 8), die IGLU-Studie (Bos, u.a., 2008, 18) belegte, dass 12-21% der Viertklässler nie aus Vergnügen lesen und des weiteren, dass ca. 10% zur Risikogruppe der späteren AnalphabetInnen gehören (Brügelmann, 2004, 1).
BREUER & WEUFFEN (2000, 17) geben die Häufigkeit einer LRS mit 12 – 25% für alle SchülerInnen an. Von den 648 untersuchten SchülerInnen (dies., 19 f.) in der Erhebung bestanden alle SchülerInnen mit ausschließlich guten Anfangsleistungen die 10. Abschlussklasse. Außerdem zeigten diese SchülerInnen zu 85% gute bis sehr gute Abschlussleistungen. Dagegen schafften 39,1% der SchülerInnen, die im Anfangs-unterricht schwach waren, die Abschlussklasse 10 nicht. Diese Ergebnisse heben die Bedeutung der Lernerfolge im Anfangsunterricht besonders hervor.
Wenn man die Untersuchungen zu oben genannter Problematik betrachtet, scheinen die Anzeichen schon sehr früh ersichtlich. Trotzdem gibt es eine erschreckend hohe Zahl von Menschen, die im Erwachsenalter Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben.
Diese Studien legen die Schlussfolgerung nahe, dass aus LRS-SchülerInnen später funktionale AnalphabetInnen werden. Oder ist es wie BRÜGELMANN (1994, 238) beschreibt, dass sie des Lesens und Schreibens unkundig bleiben. Geht vielleicht darum die Schulzeit für einige Kinder ohne erkennbaren Lernzuwachs im Schriftspracherwerb vorüber?
Die IGLU-Studie schlägt in ihren Schlussbemerkungen unter anderem die „Verbesserung förderdiagnostischer Kompetenzen der Lehrkräfte“ vor (Bos, u.a., 2008, 34). Dies erscheint ein sinnvolles Mittel zu sein, da gleichzeitig festgestellt wird, dass nur ca. ein Viertel der SchülerInnen in den Klassen mit leistungsangepasstem Material differenziert unterrichtet wird (Bos, u.a., 2008, 30). Vor allem SchülerInnen, die mit lernungünstigen Voraussetzungen und schwierigen familiären Bedingungen im Elternhaus eingeschult worden seien, liefen später Gefahr als funktionale AnalphabetInnen die Schule zu verlassen (Döbert & Hubertus, 2000, 41). Es scheint, als könnten durch die reguläre Beschulung ungünstige Startbedingungen derzeit nicht ausgeglichen werden.
2.2 Frühe pädagogische Fördermaßnahmen sind sinnvoll
Um diese beunruhigenden Zahlen zu mindern, wird immer wieder eine möglichst frühe Therapie der LRS gefordert, bzw. wird nach einer Möglichkeit zur vorschulischen Präventionsmaßnahme gesucht.
ESSER (2002, 137) weist darauf hin, dass die Hälfte aller Kinder, die in den ersten Schulmonaten große Probleme beim Erwerb des Lesens und Schreibens zeigten, schon in ihrer Vorgeschichte durch eine verzögerte Sprachentwicklung auffielen.
Zur Prävention von LRS empfehlen KÜSPERT & SCHNEIDER (2003, 110 ff.) ein spezielles Trainingsprogramm zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit schon vor der Schule. So entstand ein 20-wöchiges Trainingsprogramm, das möglichst täglich von eigens geschulten ErzieherInnen im Kindergarten, durchgeführt werden soll (Küspert & Schneider, 2002). Mehrere Untersuchungen aus dem Bereich der psychologischen Pädagogik bestätigen, dass vier- und fünfjährige Kinder, die ein spezielles Training zur phonologischen Bewusstheit erhielten, vier Jahre nach dem Training zu nachweislich besseren LeserInnen und besseren RechtschreiberInnen wurden (Siegler, 2005, 445 ff).
Ein sinnvolles Hilfsmittel, um die Gefahr einer LRS schon vor Schuleintritt zu erkennen, scheint das Bielefelder Screening zu sein. Es dient der Erfassung der vorschulischen Schriftsprachvoraussetzungen und erlaubt eine gute bis sehr gute individuelle Vorhersage von später auftretenden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Das Screening kann 4 oder 10 Monate vor Schuleintritt eingesetzt werden und testet die Fähigkeiten der Kinder zur phonologischen Bewusstheit sowie deren Aufmerksamkeit und die Vorläuferfähigkeiten zum Erlernen von Lesen und Rechtschreiben. Es enthält jedoch keine direkten Förderempfehlungen (Jansen, 1999).
BREUER & WEUFFEN (2000, 12) bemängeln, dass die Möglichkeiten, künftigen Lernschwächen vorzubeugen, bei der Durchsetzung des gesetzlich verbürgten Rechts auf einen Kindergartenplatz, meist wegen finanzieller Aspekte zu kurz kämen. Dabei seien die positiven Auswirkungen vorschulischer und frühschulischer Betreuung und Förderung national und international unstrittig und empirisch belegt. Deshalb haben die AutorInnen ein Kurzverfahren zur Überprüfung des lautsprachlichen Niveaus für Vorschulkinder und für Kinder der ersten Klasse entwickelt. Diese Diagnostik hat den Vorteil, dass konkrete Förderempfehlungen für ErzieherInnen und Eltern gegeben werden und die Anwendung dieser Differenzierungsprobe sehr leicht verständlich ist. Sie kann deshalb sofort von Eltern oder ErzieherInnen angewandt werden und benötigt weniger als eine Stunde Zeit.
Die isolierte Förderung von Teilleistungen, vor allem mit sogenannten alternativen Methoden, wird in der Fachliteratur allerdings kontrovers diskutiert und deren Wirksamkeit in Frage gestellt (vgl. Suchodoletz, 2003).
VALTIN (2010, 3) fasst mehrere Untersuchungen zusammen, die ein isoliertes Wahr-nehmungstraining der phonologischen Bewusstheit auf die spätere schulische Schreib- und Leseleistung in Zweifel ziehen. Ihr Fazit: „Der Nutzen einer expliziten und isolierten Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschulalter konnte nicht nachgewiesen werden (vgl. Rackwitz, 2008). Eine Förderung muss vielmehr direkt beim Schriftspracherwerb, das heißt in der Schule, ansetzen.“ Aus pädagogischer Sicht lehnt VALTIN (2010, 8) ein isoliertes Funktionstraining im Vorschulalter ab. Sinnvoll seien:
„- eine umfassende Sprachförderung (Wortschatz, Grammatik, Erzählen)
– spielerische Erfahrungen mit Schrift und Schriftsprache, die konzeptionelle Schriftlichkeit durch Vorlesen und den Umgang mit Büchern (und damit auch die Motivation zum Lesenlernen) fördern
– ein Anfangsunterricht, der die Kinder mit Hilfe der analytisch-synthetischen Methode direkt zur Struktur der Alphabetschrift führt.“
LÖFFLER (2000, 160 ff.) beschreibt mehrere Studien, die zeigen, dass nicht belegt werden kann, ob phonologische Bewusstheit die Voraussetzung zum Schriftspracherwerb ist oder ob sich durch den Schriftspracherwerb erst die phonologische Bewusstheit entwickelt. Die Sprachentwicklungsstörungen der erwachsenen AnalphabetInnen könnten somit aus Mangel an Schriftsprachbewusstsein entstanden sein.
Nicht nur von PädagogInnen sondern auch von HirnforscherInnen werden ein frühes Lernen und frühe Erfahrungen im Umgang mit Sprache empfohlen. „Je mehr man schon weiß, desto besser kann man neue Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen“. So zeigte ein Sprachtest in Amerika, dass wer vor dem siebten Lebensjahr ins Land kam, Englisch praktisch fehlerfrei beherrschte, je älter die ImmigrantInnen wurden, desto weniger gut konnten sie die englische Sprache fehlerfrei erlernen. „Wissen kann helfen, neues Wissen zu strukturieren, einzuordnen und zu verankern“ (Spitzer, 2006, 69). Deshalb ist ein Lernen, ausgehend vom Kenntnisstand des Lerners, am effektivsten. Knüpft dagegen der neue Lernstoff inhaltlich kaum an früher Gelerntes an, so können Vergessensprozesse einsetzen und die neuen Inhalte schwieriger abgespeichert werden (Köller & Baumert, 2002, 758 ff. aus Renkl, 1996).
Da es nach wie vor zu wenig vorschulische Sprachförderungen gibt und viele Kinder zuhause nicht optimal gefördert werden können, verlagert sich diese Aufgabe in die Schule.
2.3 Förderung nah am Schriftgebrauch
Weil sich über ein spezifisches Training von Lese- und Rechtschreibroutinen Erfolge nur langsam einstellten, wird von betroffenen Eltern, TherapeutInnen oder von LehrerInnen gerne nach Alternativen gesucht (Suchodoletz, 2003, 16 ff.). Doch seien diese alternativen Methoden noch wenig evaluiert und es gäbe so gut wie keine Wirksamkeitsüberprüfungen (ders., 2003, 242 ff.). Empfohlen werden letztendlich von den meisten Experten „lerntheoretisch begründete Therapieverfahren“ (Schulte-Körne, 2003, 53). Basale Funktionen seien nur als ausdrückliches Minimum Voraussetzung des Lesen und Schreibenlernens. Sie ließen sich auch im Umgang mit Sprache und Schrift fördern, beschreibt auch BRÜGELMANN (1994, 242). NAEGELE (1995, 87) fügt hinzu, dass LRS kein Problem der Linkshänder, keine Wahrnehmungsstörung, kein Ergebnis eines bestimmten Lernverhaltens sei, keine Störung, die sich an bestimmten Fehlerarten erkennen ließe, keine Frage der Intelligenz, keine Krankheit und keine Raum-Lagelabilität des Gehirns sei. „Lesen lernt man halt nur durch Lesen, Schreiben nur durch Schreiben“ (dies., 13). MAY (2002a, 64) erweitert dieses Statement: „Lesen lernt man nicht nur durch Lesen, sondern auch durch Schreiben – und umgekehrt“. So scheint ein frühes Lernen sehr nah am Schriftgebrauch die beste Prävention von Analphabetismus (Esser, 2002, 142; vgl. Naegele, 1995).
Wie ESSER (2002, 137) bemerkt und später bei erwachsenen Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben immer wieder feststellbar wird, leiden sehr viele der Betroffenen unter Sprachentwicklungsstörungen. LÖFFLER (2002, 65) führt an, dass der Schriftspracherwerb die Fähigkeit unterstütze, deutlich oder auch Standardsprechsprache zu sprechen, da die Aussprache der Wörter am Schriftbild orientiert werden könne. FÜSSENICH (2011, 10) zitiert aus ONG (1987), dass das Lesen- und Schreibenlernen ein kognitiver Konstruktionsprozess sei und durch das Schreiben das Denken neu konstruiert werde. Solange Schrift nicht verfügbar sei, wären einige kognitiv-sprachliche Leistungen kaum möglich (Füssenich, 2011, 10 aus Lurija, 1986). Menschen ohne Schriftsprachkenntnissen fehle die Fähigkeit, über formale Aspekte der Sprache nach-zudenken sowie wissenschaftliche Begriffe anzuwenden (dies., 2011, 10). Die Integration von Gesehenem und Gehörten sei die Voraussetzung dafür, dass die Lautung und Schreibweise von Wörtern erfolgreich gelernt und einander zugeordnet werden könnten (Blakemore & Frith, 2006). Somit schult der Schreibunterricht nicht nur das Schreiben, sondern auch die Sprache und die abstrakte Denkfähigkeit. Das Nachdenken über Sprache und deren Bedeutung setzt ein.
All dies sind gute Gründe die SchülerInnen früh beim Rechtschreibunterricht zu begleiten, rechtzeitig Schwachstellen zu kennen und spezielle Fördermaßen einzuleiten. Für die Alphabetisierung gelten alle oben genannten Vorteile. In jedem Alter kann dazugelernt und bestimmte Strukturen können verändert werden.
LINDIG (2008, 7 ff.) unterstreicht, dass die Bedeutung der Schrift heute größer sei als je zuvor in der Kulturgeschichte. Dies hinge vor allem mit den gestiegenen Anforderungen der Berufsqualifikation zusammen.
Das bestätigt sich in meiner praktischen Arbeit. Die Zahl der erwachsenen LernerInnen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Aktuell wurden mir vier Erwachsene von ihren Arbeitgebern geschickt: Eine Juristin und eine Mediendesignerin, weil sie die berufliche Anforderung in der Rechtschreibung nicht erfüllen; Ein Maler- und ein Friseurlehrling, weil sie außerdem Probleme im Textverständnis zeigen und deren Ausbilder deshalb Sorge haben, sie könnten die Ausbildung nicht erfolgreich bestehen.