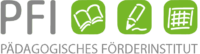1 – Einleitung
Die Idee zu dieser Arbeit entstand aus meiner praktischen Tätigkeit. Da ich seit mehreren Jahren ein LOS-Institut zur Förderung von SchülerInnen mit einer Lese-/Rechtschreibschwäche*[1] (LRS) leite und wir seit Jahren standardmäßig die Erstdiagnose der Rechtschreibleistung unserer SchülerInnen mit der Hamburger Schreibprobe (HSP) erstellen, will ich erforschen, ob das computerbasierte Nachfolgeverfahren schreib.on dieselben qualitativen Ergebnisse bietet und welche Unterschiede sich bei der Handhabung zeigen.
Beide Verfahren wurden von Dr. Peter May entwickelt, greifen auf die gleichen wissenschaftlichen Untersuchungen und Datenmaterialien zurück und sollten daher ähnliche Erkenntnisse liefern. Da die schreib.on erst seit 2008 verfügbar ist, gibt es derzeit noch keine mir bekannten Vergleichsstudien.
Mich interessieren im Besonderen die Vergleiche der Auswertung, deren Handhabung im schulischen Alltag sowie die Akzeptanz bei SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und sonstigen Beteiligten. Die Ergebnisse ihrer Beurteilungen flossen in die Untersuchung mit ein, um zu einem möglichst praxisnahen Ergebnis zu kommen.
Außerdem wird in dieser Arbeit näher auf den Unterschied der verschiedenen Diagnoseverfahren im Kontext der Lese-/Rechtschreibschwäche und deren Therapie eingegangen, Vor- und Nachteile werden erläutert und diskutiert. Auf die Bedeutung des Rechtschreibunterrichts und Frühfördermaßnahmen wird gesondert eingegangen.
Zur Datenerhebung wurden alle SchülerInnen, die zwischen April und Dezember 2011 im Institut gefördert wurden, mit beiden Verfahren getestet und befragt. Die Bandbreite der ProbandInnen reichte von der ersten bis zur dreizehnten Klasse, von FörderschülerInnen bis GymnasiastInnen und von erwachsenen AnalphabetInnen bis zur studierten JuristIn. Die Vorerfahrungen und Lernausgangslagen streuten sehr weit, so dass viele unterschiedliche Testsituationen möglich waren.
Am meisten beeindrucken mich Erwachsene mit großen Problemen beim Lesen und Schreiben. Wie diese funktionalen AnalphabetInnen* ihr Leben trotzdem meistern gleicht oft einem Kunststück. Welch leidvolle Schulerfahrungen sie auch hinter sich haben trotzdem sind sie guten Mutes ein neues Lernexperiment mit mir einzugehen. In den Biographien dieser Menschen konnte ich immer wieder den gleichen „Bruch“ entdecken. Irgendwann ab der 2. Klasse haben sie den Anschluss verloren. Sie wurden zwar weiterhin beschult, aber die Passung von Unterrichtsstoff und ihren momentanen Fähigkeiten war nicht mehr gegeben. Der schulische Unterricht lief praktisch ohne ihre Teilnahme weiter. Diese eindrücklichen Schilderungen ließen sich durch Einblicke in deren Zeugnisse bestätigen.
Mit Hilfe von Lernstandsdiagnosen kann Unterricht in einer Klasse besser differenziert und an die Bedürfnisse der einzelnen SchülerInnen angepasst werden. Sie können noten- und klassenunabhängig, während des Unterrichts, durchgeführt werden. Durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg wird die Vielfalt in den Klassen steigen und das Unterrichtsangebot sollte noch genauer auf die nicht homogene Schülerschar zugeschnitten werden.
In meiner täglichen Praxis mache ich die Erfahrung, dass eine spezielle Zusatzförderung bei einer Lese-/Rechtschreibschwäche von den Schulen, wenn überhaupt, meist erst ab der dritten Klasse angeboten wird. Zu diesem Zeitpunkt haben stark lese-/rechtschreibschwache Kinder schon den Anschluss verloren, jedoch sind gerade die Anfangsschulerfolge sehr häufig ausschlaggebend für die weiteren Schulerfolge.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, die HSP und die schreib.on kennen zu lernen, um den Lehrenden die Entscheidung für eines der beiden Verfahren zu erleichtern. Es wird erörtert, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Instrumente bieten und wann beide Verfahren anwendbar sind.
[1] Da es für die aufgeführten Fachbegriffe oft unterschiedliche Erklärungen gibt, sind alle mit Stern versehenen Begriffe im Glossar so aufgenommen, wie sie für diese Arbeit verstanden werden wollen.