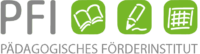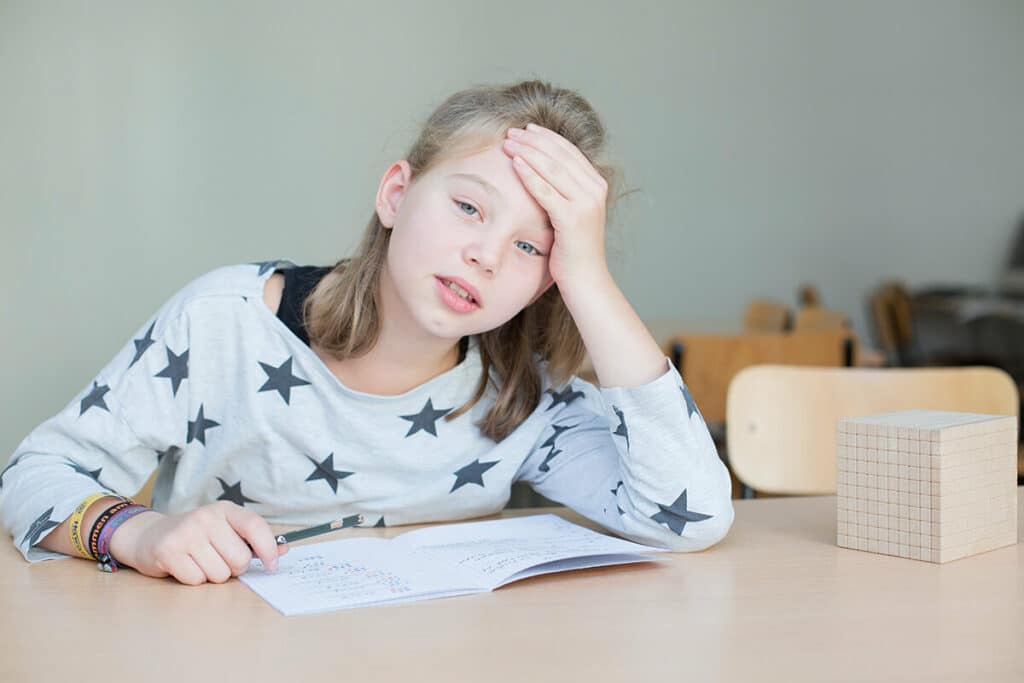Vor ungefähr 2.000 Jahren fing alles an: Römische Soldaten des Kaisers Augustus überschritten die Alpen und eroberten große Gebiete Mitteleuropas bis zur Donau. Es folgten noch viele Kaiser und viele weitere Eroberungen weiter nach Norden und damit der Einzug der lateinischen Sprache und Schrift in die gesamteuropäische Kultur: Latein wurde so für mehr als 1.000 Jahre Wissenschafts-, Kirchen- und Amtssprache, auch über das römische Reich hinaus.
Deutsch wurde in der Folge mit lateinischen Buchstaben geschrieben, obwohl diese nicht so richtig zur deutschen Sprache passten. Das ist auch nicht überraschend! Denn es wird versucht, 41 Phoneme, die Standardlaute der deutschen Sprache, mit nur 26 Buchstaben – zählt man ä, ö, ü, ß dazu sind es sogar 30 Buchstaben – des lateinischen Alphabets zu schreiben. Außerdem sind häufige Schrifteinheiten wie zum Beispiel ch, ei, au, sch im lateinischen Alphabet nicht enthalten. Andererseits werden etliche lateinische Buchstaben wie v, q, c nicht unbedingt für das Schreiben von deutschen Wörtern benötigt, da es keine entsprechenden Laute im Deutschen dafür gibt oder diese dann doppelt existieren.
Es gibt beispielsweise Sprachen wie Dänisch und Türkisch, die deutlich lautgetreuer sind, d.h. für jeden gesprochenen Laut wird nur ein Buchstabe oder eine eindeutige Buchstabenkombination geschrieben. Das Erlernen solcher Schriftsprachen fällt dann deutlich leichter, während man sich bei uns nicht zu wundern braucht, dass Kinder, aber auch manche Erwachsene, Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen haben!
Ein komplexer Prozess
Wie man es auch dreht und wendet: Das Schreiben und Lesen sind sehr komplexe Prozesse des Dechiffrierens. Beim Schreiben hören oder stellen wir uns Laute – Phoneme – vor und ordnen diesen bestimmten Bildern von Buchstaben oder Buchstabenkombinationen – Graphemen – zu. Beim Lesen sehen wir diese Buchstaben-Bilder und erzeugen dafür Laute, zunächst in unserem Gehirn und dann tatsächlich mit unseren Stimmbändern. Beide Prozesse erfordern enorme Anstrengungen und einen großen Energieaufwand.
Bei guten und versierten LeserInnen und SchreiberInnen ist ein Großteil dieser Abläufe vollständig automatisiert und es werden fast immer ganze Wortteile, Worte oder sogar noch größere Sinneinheiten direkt – ohne Umweg der kleinteiligen Dechiffrierung – erkannt und gelesen oder geschrieben. Ist Lesen und Schreiben automatisiert, können sich die meisten Erwachsenen nicht mehr daran erinnern, wie anstrengend das Lernen des Lesens und Schreibens war. Wenn Laute und Buchstabenfolgen nicht gut zusammengeführt werden oder falsche, beziehungsweise nicht genügend, Wortbilder abgespeichert werden können, fällt das Erlernen dieser Kompetenzen deutlich schwerer. Manchen Kindern und Erwachsenen gelingt auch noch aus anderen Gründen (z.B. aufgrund von Sprachfehlern) diese Dechiffrierung nicht oder nicht ausreichend und sie benötigen dann zum Teil deutlich mehr Unterstützung. Unabhängig von den Ursachen lernen die Geförderten im PFI dann individuell, gezielt und Schritt für Schritt ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Vielen unserer Schüler und Schülerinnen gelingt es bereits nach kurzer Zeit schon deutlich besser mit der Schriftsprache umzugehen.
Ihr Johann Dillmann – Institutsleiter des PFI Sindelfingen